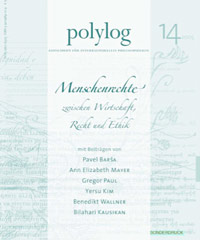tipps – blog – presse – veröffentlichungen – abgasskandal – chronik
unsere veröffentlichungen
Bücher, Vorträge, Zeitschriftenartikel …
Benedikt Wallner, Anwalt bei Deinhofer-Petri-Wallner. Kläger müssen hinnehmen, dass Verfahren sehr lange dauern. Warum aber in ein Schiedsverfahren zwingen?
Auch wir Klägeranwälte brauchen eine Lösung für das Problem, dass Anlegerverfahren nicht mehr in schicklicher Zeit zu einem Titel führen. Und wie kommen erst all die anderen Kläger dazu, hinzunehmen, dass die Gerichte - durch Tausende Anlegerklagen verstopft - nun auch für ihre Bausachen etc. keine Zeit mehr haben? Sie alle mussten die Justiz bereits vorab für ihr Tätigwerden bezahlen, wir natürlich ebenfalls: Denn Gerichtsgebühr wird bereits bei Klagseinbringung fällig. Massenhafter Vertrieb erzeugt eben auch Massenschäden, die werden immer wieder auftreten. Ein leichtsinniger Gesetzgeber, der darauf nicht reagiert, lässt derzeit zu, dass unser hohes, ausdifferenziertes Niveau der Rechtsverfolgung verfällt. Über so einen Verfall können sich nur die Rechtsbrecher freuen.
Skepsis
Dennoch ist Vorschlägen zur Justizentlastung mit Skepsis zu begegnen. Eine Entlastung der Justiz kann ja nicht der Zweck sein, sondern höchstens eleganter Nebeneffekt des eigentlichen Zwecks, selbst Tausenden Geschädigten noch in brauchbarer Form zu ihrem Recht zu verhelfen!
Beispiele dafür wurden von der Praxis längst entwickelt, vgl. jüngst das Amis-Urteil. Wenn tausendmal dieselbe Rechtsfrage und die ungefähr gleiche Tatfrage zu lösen anstehen, dann liegt es durchaus nahe, sie pars pro toto abzuarbeiten. Auch Rechtsverfolgung lässt sich rationalisieren. Massenkläger brauchen keinen Maßschneider; sie wollen einfach ihr Geld zurück, und das bei geringem Einsatz. In einem vorläufigen Schiedsverfahren kann so ein vollstreckbarer Vergleich - der wohl nicht allzu hoch ausfallen wird - für viele, vor allem kleinere Schäden wenigstens etwas Linderung bedeuten, noch dazu rasch. Die im Wohnrecht jetzt schon obligatorischen Schlichtungsverfahren verzögern und verteuern aber die großen Causen, weil das Verfahren im sukzessiven Instanzenzug wiederholt wird.
Recht
Das wird auch hier, beim angedachten Anlegerschiedsverfahren, wieder so sein. Warum also einen Kläger, der von vornherein Recht und nicht Mildtätigkeit anstrebt, zuvor in das Schiedsverfahren zwingen? Außerdem: Schließt man von vornherein die Klagsmöglichkeit (für einen bestimmten Zeitraum) aus, indem man ein obligatorisches Schiedsverfahren vorlagert, schraubt man damit das allgemeine Ersatzniveau tendenziell nach unten.
Quelle: WirtschaftsBlatt, Print-Ausgabe, 2012-09-05
Erst wenn der letzte Bankomat versiegt ist, werdet ihr feststellen, dass ihr Geld zum Essen braucht
Quelle: Benedikt Wallner in: polylog, Zeitschrift für interkulturelles Philosophieren, Nummer 23, Juli 2010, GELD
"Kontrolle ist gut. Vertrauen wäre besser, meint RA Dr. Benedikt Wallner ..." in seinem Artikel in der Zeitschrift ANWALT AKTUELL 01/10:
Konsumenten bräuchten Berater, die im oft schwer verständlichen Dschungel der Finanzprodukte für sie da sind und ihnen das für sie beste, auf dem Markt erhältliche Produkt heraussuchen
Wofür brauchen Konsumenten Vermittler? Gibt es sie, weil es sie eben gibt? Weil sich in dieser Branche viel und leicht Geld verdienen lässt? Oder braucht sie eigentlich die Industrie, um ihre Produkte unter den Konsumenten abzusetzen und die Konsumenten Glauben zu machen, jemand Unabhängiger würde sie ihnen empfehlen? Und ist das den Konsumenten eh ausreichend klar? Wie dem auch sei, nach dem Urteil des Obersten Gerichtshofs 4 Ob 62/11p ist die Welt wieder ein wenig besser geworden:
Faule Finanzprodukte hatten mehrere Väter, deswegen waren die tausenden Klagen der letzten Jahre einmal gegen den Vertrieb, ein andermal gegen den Emittenten, und in manchen Fällen auch noch gegen andere gerichtet. Jedoch, wurde der Emittent geklagt, so zeigte der mit dem Finger auf den Vermittler: der war's, der hätte "richtig aufklären" und "seine Kunden" richtig beraten müssen, so ein riskantes Produkt wie wir es herausgeben sei doch bitteschön nichts für den risikoaversen Kleinsparer!
Das lange Warten
Wurde aber der Vertrieb geklagt, zeigte der flugs auf den Emittenten: was, bitteschön, können denn wir dafür, wenn die Herren im Nadelstreif horribile dictu krumme Sachen machen? Und das sehe man doch schon an dem eingeleiteten Strafverfahren, dass das krumm war, wer rechnet denn mit so was? Jetzt warten wir mal in aller Ruhe das Strafverfahren ab (bei LIBRO dauerte es zB 7 Jahre bis zur Anklageschrift - manchem Kläger geht inzwischen die Luft aus), das Warten freut auch die ob der tausenden Klagen überlasteten Handelsrichter, und dann wird man schon sehen, dass wir vom Vertrieb nichts falsch gemacht haben, indem wir nur auf das vertraut haben, was uns vom Emittenten gesagt wurde.
Geht so nicht, sagt der OGH, und macht sich dazu viele, kluge und abwägende Gedanken. Steht nämlich so nicht im Gesetz, das doch den Vertrieb zu eigener Sorgfalt verpflichtet. Der hätte nachprüfen müssen, ob das im Mindesten so stimmen kann, wie es ihm vom Emittenten gesagt wurde: Ob MEL sparschweinmäßig sichere, österreichische Aktien sind oder bloß außereuropäische Zertifikate. So ist es auch gleichgültig, aus welchem Grund die vermittelten Papiere an Wert verloren haben; auf den Ausgang des Strafverfahrens brauchen wir also gar nicht zu warten, die fehlerhafte Beratung macht den Vertrieb jedenfalls haftbar.
Finaler Schlag gegen ignorante Vermittler
Sapperlot, Sorgfalt! Woran erinnert uns das? Vor 20 Jahren hat es schon einmal eine Vermittlerbranche arg erwischt, als nämlich die Ziviljustiz anfing, zu erkennen, dass die "schwarze" Ablöse bei Mietwohnungen, die trotz strikten Verbots seit Menschengedenken Praxis gewesen war, auch vom Immobilienmakler zurückverlangt werden kann. Viele Unternehmen überlebten das nicht. Die Branche reorganisierte sich, führte Ausbildungsvorschriften ein. Wer heute noch als Immobilienmakler tätig ist, übervorteilt seine Kunden mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr, sondern nützt ihnen.
Finaler Schlag gegen ignorante Vermittler
Und in diese Richtung geht es nun auch bei den Finanzberatern. Der Marktführer hat schon längst angekündigt, künftig nur mehr geprüftes Personal einzusetzen. Pyramidenartige Anreizsysteme im Strukturvertrieb, die den Berater an der Front geradezu zwingen, auf Teufel komm raus Abschlüsse zu tätigen, auf dass die Ebenen oberhalb ein feines Auskommen haben, werden genauer beäugt, echte Pyramidenspiele wären schließlich strafbar. Schwarze Schafe oder schwarze Herde, so oder so wird der Markt gerade bereinigt.
Ganz am Ende könnte gar etwas herauskommen, was Konsumenten angesichts wegbrechender staatlicher Pension und erodierender Großbanken, die sich nur mehr mit Staatshilfe kurzfristig über Wasser halten, wirklich brauchen: Berater, die im oft schwer verständlichen Dschungel der Finanzprodukte just für sie da sind und ihnen das für sie beste, auf dem Markt erhältliche Produkt heraussuchen; und zwar weltweit, denn wozu sich auf den unterentwickelten Finanzplatz Österreich beschränken?
Dieses Ziel wäre einfach zu erreichen, müssten die Konsumenten die Berater selbst bezahlen (zB mittels Erfolgsprovision) und wäre es den Emittenten untersagt, den Beratungsunternehmen Provisionen zu gewähren - was in Österreich allerdings wieder nicht so gut kommt. Lieber erliegen wir der Illusion, die Tätigkeit des Beraters sei irgendwie "gratis" und dennoch für uns da. Ein Anfang wäre schon die deutliche Unterscheidung zwischen interessegeleitetem Vertrieb einerseits und unabhängigem Berater andererseits, um wenigstens offenbar zu machen, wes Brot wer isst.
Leser-Kommentar, Benedikt Wallner, derStandard.at, 5.8.2011
Autor: Dr. Benedikt Wallner, geb. 1963, Rechtsanwalt in Wien (Kzl. Deinhofer.Petri.Wallner), spezialisiert auf Verbraucher- und Anlegerrecht, vertritt u.a. die AK
Wozu verhilft ein konstruktionistisches Wirklichkeitsmodell? (1)
Die Feststellung juristisch relevanter Tatsachen ist die Voraussetzung juristischer Entscheidungen und daher von größter Wichtigkeit. Sich der dem Wirklichkeitsverstehen vorausgehenden Mechanismen bewusst zu werden, bringt Licht ins Dunkel juristischer Entscheidungsfindung.
Wie stellen RichterInnen Tatsachen fest? Fragen Sie danach, und Sie bekommen häufig als Antwort zu hören, wie schwierig die Tatsachenfeststellung ist; fragen Sie Lehrbücher, so stoßen Sie irgendwann vermutlich auf die mittlerweile klassische Auffassung von Engisch (2), wonach „Tatsachenfeststellung und (rechtliche) Subsumtion begrifflich streng geschieden (sind).“ Jene habe es mit der Existenz von „wirklichkeitsartigen“ Gegenständen zu tun, deren Vorhandensein letztlich aufgrund von Wahrnehmungen festgestellt werde; die Subsumtion drehe sich hingegen um die Gleichsetzung des konkreten Falles mit den vom gesetzlichen Tatbestand gemeinten Fällen aufgrund von Wertung oder Erfahrung. (3) Offen bleibt die Frage, wie herausgefunden wird, ob jene bestimmten Momente im konkreten Fall vorliegen, die der gesetzliche Tatbestand beschreibt: Dies sei nach Engisch „durch die üblichen Beweismethoden aufzuklären.“ (4)
Zwar war es gerade Engisch, der mit seinem „berühmtesten Nebensatz“ (5) betont hat, dass Tatsachenfeststellung und rechtliche Beurteilung nicht in einem zeitlichen Nacheinander ablaufen können, sondern es eines ständigen „Hin- und Herwandern des Blickes“ zwischen Lebenssachverhalt und Rechtsbegriffen bedarf: (6) Nicht alles was geschehen ist, ist für die rechtliche Beurteilung wesentlich. Auf der anderen Seite sind nur jene Normen für den einzelnen Fall bedeutsam, die auf das tatsächlich Geschehene zumindest abstrakt anwendbar sind. Zwar hat also Engisch die Position vertreten, dass keine allgemeingültige Methode im Sinne einer „Betriebsanleitung“ angegeben werden könne, wie Urteilsbildung in den Köpfen der RichterInnen vor sich zugehen hat, sondern er sieht die Beweiswürdigungsarbeit in allen ihren Facetten eher, wie es der OGH ausdrückt, als eine „kritisch-psychologischen Vorgang“, (7) der zu „voller Gewissheit“ (8), nach anderer Meinung auch zu „persönlicher Gewissheit“ (9), wenn auch nicht zu von allen Zweifeln freier Überzeugung“ (10) führen soll. Dem ist zunächst vollauf zuzustimmen, weil sich alle Versuche, richterliche Beweiswürdigungsarbeit – wie menschliches Urteilen im allgemein – deterministisch zu beschreiben, als zu oberflächliche Annäherungen an das Phänomen der menschlichen Urteilskraft erwiesen haben.
Engisch bleibt aber eine Erklärung für den Vorgang des Beweisens schuldig, die versucht, den Vorgang richterlicher Tatsachenfeststellung zu beschreiben. Richterliche Tatsachenfeststellung könnte als allgemeiner Verstehensprozess beschrieben werden: Die Kognitionstheorie hat nach Schmidt (11) zuletzt Verstehenstheorien entwickelt, womit zwei Standard-Hypothesen verworfen werden, die zumindest die Alltagshermeneutik, aber auch diejeniger vieler WissenschaftlerInnen und vermutlich auch diejenige viele RichterInnen (bzw. RechtsanwenderInnen) immer noch bestimmen:
a) Verstehen sei „Bedeutungsentnahme“ aus einem Text (Schriftsatz, Schilderung eines zusammenhängenden Geschehnisablaufes durch Zeugen) und
b) der bedeutungstragende Text (Sachverhalt) determiniere den Verstehensvorgang.
Stattdessen entstehen zwei neue Hypothesen:
a1) Verstehen resultiert vielmehr aus der Interaktion von Sprecherwissen und Textinformation, ist also ein Austarieren von schemageleiteten und textgeleiteten Operationen und
b1) Verstehen ist ein subjektzentrierter, strategiegeleiteter, intentionaler und effizienzorientierter, flexibler Prozess (12)
Auch das richterliche Verstehen von Sachverhalten wäre demnach ein zielgerichteter Vorgang, darauf gerichtet, die den Rezipienten/Richter umgebende Welt durchsichtig, intelligibel zu machen. Dieser Befund harmoniert mit den Erkenntnissen der Systembiologie ebenso wie mit konstruktivistischen Ansätzen der Erkenntnistheorie: Wir machen im Allgemeinen die uns begegnende Welt sinnvoll, indem wir Zusammenhängende konstruieren. Verstehen ist ein Konstruktionsvorgang, zu welchem die einzelnen Wörter des Satzes („die einzelnen Elemente des Sachverhaltes) das beitragen, was hier für den Zusammenhang gebraucht wird, ... aber alles, was potentiell in ihnen steckt. Demnach ist etwa die verstehende Verarbeitung einer Äußerung erst dann zu Ende, wenn das Ergebnis den Hörer/Rezipienten/Richter hier und jetzt befriedigt. Es befriedigt ihn, wenn es sinnvoll ist. (13)
Das erinnert an Fuciks Definition, wann die RichterInnen im Beweisverfahren aufhören können und dürfen, weiterhin an den bisherigen Sachverhaltsergebnissen zu zweifeln: Wenn sie durch den „Quantensprung“ der Beweiswürdigung, durch den „in procedendo interessierende Quantität (Wahrscheinlichkeit) in iudicando in Qualität (Überzeugung) umschlägt“, mithin von einer der angebotenen Sachverhaltsversionen überzeugt sind (14).
Die Verstehens-Konzeption sagt darüber hinaus, wenn und unter welchen Bedingungen es zu diesem „Quantensprung“ kommt: Ziel eines Verstehensvorganges ist die Einordnung der zu verstehenden Neuigkeiten in ein keineswegs leeres, sondern fast vollständig mit Prägungen, Erwartungen, Neigungen, Erfahrungen und Vorverständnis vollgeräumtes „Informationslager“. Der Quantensprung wird dann eintreten, wenn die Einordnung zur Zufriedenheit des „Lagerhalters“ erfolgt und abgeschlossen ist.
Zum Unterschied zu einem, an der so genannten „Objektivität“ orientierten Tatsachenfeststellungs-Konzept sind RichterInnen hier zugleich aktiver wie passiver Teil eines ganzheitlichen, mentalen Konstruktionsaktes.
Dabei könnte das Verstehen entweder eine über die Sachverhaltselemente angeleitete Aktivierung von Konzepten im Kopf des Rezipienten/Richters mit der Absicht sein, diese zu modifizieren und in neue Relationen einzubinden, (15) oder es könnten Dispositionsfaktoren im Verstehensprozess eine dominante Rolle spielen und Verstehen also letztlich von Kosten-Nutzen-Erwägungen abhängen, da ja jede/r RezipientIn nur soviel Zeit und Energie in den Verstehensprozess investiert, wie ihr/m die Aussage wert ist. Der wesentliche Gegensatz zwischen diesen beiden Auffassungen liegt in der Rolle des verstehenden Subjektes, die einmal aktiv und einmal passiv ausfällt: Ist das Verstehenssubjekt mit Früh (16) bezweifelt werden. Demnach hängt Verstehen nämlich ab vom
- kognitiven Potential der RezipientInnen, so von der Differenziertheit
- ihres Wirklichkeitsmodells,
- ihrer Vorinformationen und
- der ihnen verfügbaren Denkstrategien (Potential subjektiver Informationsverarbeitung);
- von der Toleranzspanne in Bezug auf diskrepante Informationen oder Informationsüberschuss;
- vom momentanen affektiven Zustand (Stress, Angst, Depression, Erwartungshaltungen, etc.)
- vom Interesse am Thema
Hier scheint sich die Auffassung zu bestätigen, dass man – auch siech selbst! – nur das beweisen kann, was man beweisen will und die Dispositionen, welche letztlich den Ausschlag hinsichtlich des Beweises in die eine oder andere Richtung geben, offenbar bereits in einem Vorfeld der Letztentscheidung zu treffen sind, in dem sich entscheidet, was man beweisen möchte.
Einer der zentralen Begriffe der Verstehensforschung ist Kommunikation. Kommunikation ist nach Schmidt (17) keineswegs, wie Informationstheoretiker behaupten, ein Prozess nach dem üblichen Schema: <Sender S sendet eine Botschaft B an Empfänger E>, sondern eine Interaktion zwischen gleichermaßen aktiven Kommunikanten. Kommunikation scheint Interaktanden in die Lage zu versetzen, gegenseitig koordinierte Verhaltensweisen auszulösen. Als soziales Phänomen ist sie ein zentrales Instrument sozialer Wirklichkeitskonstruktion im und durch das Individuum. (18)
Kommunikation im so verstandenen Sinne ist eigentlich, mit Luhmann, etwas ziemlich unwahrscheinliches, auch wenn sie jeden Tag erlebt und praktiziert wird. Dies deswegen, weil die Kommunikationspartner voneinander getrennte und individualisierte Bewusststeine und Gedächtnisse haben; weil Aufmerksamkeit ein begrenztes Gut ist; weil schließlich nie vorausgesehen werden kann, ob eine „verstandene“ Kommunikation auch denk- und handlungsbestimmend wirkt. (19)
Kriterien erfolgreicher Kommunikation, die also eine Voraussetzungslast zu bewältigen hat, womit verglichen die Beherrschung der benutzten Sprache geradezu nebensächlich ist, können angegeben werden; dabei soll im Folgenden gleichzeitig der Versuch gemacht werden, jedem Kriterium die jeweilige Entsprechung in der Zivilprozessordnung zuzuordnen:
Kommunikationspartner müssten (20) unter anderem:
- Sich gegenseitig Kommunikationsbereitschaft und Aufrichtigkeit zubilligen
- (in den Prozessordnungen grundsätzlich verankert durch Wahrh[aftigk]eitspflicht);
- zur Kommunikation disponiert, fähig und motiviert sein (entspricht Anwaltspflicht bzw. richterlicher Anleitungspflicht im Prozess);
- Erkennen, in welchem Diskurs die Kommunikation stattfindet und welche thematischen Beiträge in einer bestimmten Situation von bestimmten Partnern erwartet werden (Beweiserörterung, Rechtsgespräch);
- Gattungen, Rede- und Stilformen beherrschen (anwaltliche Vertretung);
- Die Sozialstruktur einer Kommunikationssituation erkenn und angemessen berücksichtigen, um Verteilungen von Kommunikationsanteilen erfolgreich einschätzen und gesellschaftlich wichtige Sprachregister wie etwa Höflichkeitsformeln richtig handhaben zu können (wiederum anwaltliche Vertretung);
- Sich ein erfolgreiches Bild vom Kommunikationspartner machen, um seine Absichten, sein Wissen, seine Interessen, seine Gefühlslage, seine Annahme- und Abwehrbereitschaften einschätzen zu können (anwaltliche Vertretung, insbesondere Intervention).
Kommunikation bedeutet nicht bloß etwas mitteilen, sondern auch den Anspruch auf die Aufmerksamkeit und die – als höchst aktiv vorgestellte! – Verstehenstätigkeit eines anderen zu erheben: Ohne die anderen, ohne die Kommunikationspartner, ist nicht nur Kommunikation unmöglich bzw. sinnlos; unmöglich wird dann jegliche subjektgebundene Wirklichkeitskonstruktion („Tatsache“), weil alle Wirklichkeitsmodelle sich in der Interaktion bestätigen müssen, um als gemeinsame Wirklichkeit zum Bezugspunkt von Erleben und Handeln werden zu können. (21)
Dies darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Bereich des Bewusstseins und der Bereich der Kommunikation vollständig autonom sind und sie sich nicht überlappen können. Was letztlich beim Vorgang zB der richterlichen Beweiswürdigung im Rezipienten passiert, entzieht sich jeglicher deterministischer Beschreibung. Ein noch so mächtiger Gedanke, schreibt Baecker (22), eine noch so mitreißende Mitteilung, eine noch so bedeutungsschwere Information sind keine Gedanken. Alles was die Kommunikation vermag, ist das Auslösen bestimmter Bewusstseinsinhalte im Adressaten, und dies nur unter bestimmten – wenn auch üblicherweise gegebenen – Voraussetzungen. Gleichzeitig ist Verstehen auch ein sozialer Prozess in situativen und sozialen Kontexten. So etwas wie ein „objektives Verstehen“ gibt es nicht und – als eine Unterform des Verstehens - demnach auch kein objektives Feststellen.
Für gewöhnlich herrscht nun Einigkeit darüber, dass „die Wahrscheinlichkeit nicht vollständig erkennbar“ ist und man sich ihr immer nur annähern könne. Das Diktum von der nicht bis ins Letzte feststellbaren, aber doch prinzipiell vorhandenen, außenliegenden Wirklichkeit fungiert allerdings auch vielfach als Immunisierungsstrategie: Also begnügen wir uns mit dem, was einfach zu erkennen ist.
Die Auffassung von Wirklichkeit als Konstrukt bedeutet jedoch, dass zwar keine invariante, außenliegende Objektivität, grundsätzlich aber sehr wohl und gerade deswegen Erkennbarkeit vorliegt, nämlich innerhalb der Grenzen dessen, was intersubjektiv für Wirklichkeit gehalten wird: eine auf Kommunikation beruhende, soziale Übereinstimmung. Innerhalb dieses Rahmens (a) findet Verstehen und Beweisen statt, (b) ist es sehr wohl sinnvoll, von „Tatsachen“ zu sprechen und (c) hat man sich aber auch um die genaue Feststellung von Tatsachen zu bemühen. (23)
Jeder einzelne Akt der Beweiswürdigung, der zu einer Urteilsbildung über den Sachverhalt führt, muss als emergentes Phänomen beschrieben werden (Emergenz bezeichnet das plötzliche Auftreten einer neuen Qualität, die sich jeweils nicht durch die Eigenschaften oder Reaktionen der beteiligten Elemente erklären lässt, sondern nur durch eine jeweils besondere, selbstorganisierende Prozessdynamik (24)). Die oft für absolut gehaltenen Gesetzmäßigkeiten der Naturwissenschaften sind ebenfalls bloß Anschauungsformen. Nach Prigogine/Stengers handelt es sich bei einem „Naturgesetz“ eher um eine Wette. (25) Auch in den Naturwissenschaften treffen wir keineswegs auf ein unvoreingenommenes Beobachten natürlicher Vorgänge, welches sodann in physikalischer, biologischer, chemischer etc. Weise „gewürdigt“ würde. (26) Wie bei aller menschlicheren Erkenntnis, finden wir auch dort eine Art von Engischs Hin- und Herwandern des Blicks zwischen dem Bild, das wir feststellen möchten oder feststellen zu können glauben und dem zu interpretierenden „Material“, dem Phänomen, dem Sachverhalt „Das untersuchte Phänomen muss präpariert und isoliert werden, bis es einer idealen Situation nahe kommt, die zwar physikalisch unerreichbar sein mag, aber dem angenommenen begrifflichen Schema entspricht.“ (27) Gadamer zur weitverbreiteten Wissenschaftsgläubigkeit: „Selbst eine Weltgleichung, die alles Seiende zur Abbildung brächte, sodass auch noch der Beobachter des Systems in den Gleichungen des Systems aufträte, setzte noch immer den Physiker voraus, der als der Rechnende nicht der Berechnete ist. […] Als Wissenschaft hat die (Physik) den Gegenstandsbereich vorentworfen, dessen Erkenntnis seine Beherrschung bedeutet.“ (28)
Wenn Engisch das rechtliche Urteil auf den für hinreichend sicher gehaltenen, naturwissenschaftlichen Methoden der Sachverhaltsfeststellung aufbauen wollte, diese selbst sich aber für unzuständig erklären, weil auch sie schemageleitete Feststellungen treffen und keineswegs imstande sind, „bloß“ zu beschreiben, was sie sehen, geht uns das Fundament für die Begründung des rechtlichen Urteils verloren.
Manchmal wird der „festgestellte Sachverhalt“ als in der Rechtssprache eigenständig definiert verstanden und ihm eine andere Bedeutung beigemessen als in der Alltagssprache. Das wird zum Teil gemacht, wenn von dem „als feststehend angenommenen“ Sachverhalt die Rede ist. Aber abgesehen davon, dass nicht auf Entitäten, die auch außerhalb der Rechtssprache einen wohlverstandenen Sinn ergeben, fehlte dann auch jegliche Einflussnahme rechtlicher Regeln auf reale Lebenssachverhalte; die beiden Welten hätten nichts mehr miteinander zu tun. Der Begriff vom festgestellten Sachverhalt muss daher immer in einer Weise verstanden werden, die auch in der Alltagssprache einen hinreichend definierten Sinn ergibt.
Aus diesem Grunde stimmt es nicht, dass es in der richterlichen Beweiswürdigungsarbeit ja nur darum gehe, einen Sachverhalt als festgestellt angenommen zu bezeichnen. Vielmehr ist auf der seit Aristoteles unter anderem auch von Engsich vertretenen Forderung zu beharren, dass das rechtliche Urteil einen Anspruch auf Wahrheit oder Richtigkeit erhebt, welchem Anspruch nicht dadurch genüge getan wird, dass wir etwas als Wahrheit annehmen oder ausgeben, sondern nur dadurch, dass wir diese Wahrheit ermitteln. Der jeweilige Fall wäre dann allerdings nicht mehr an einer, als unveränderbar und subjetunabhängig vorgestellten Wahrheit auszurichten, welche für sich genommen, ohne jede Interpretation, ein sinnloser Begriff ist, sondern wäre umgekehrt die Wahrheit pro Fall auszurichten und also jeweils zu konstruieren. Dabei dürfen nie die bisherigen Überzeugungen und Vormeinungen außer Acht gelassen werden, welche bislang den Rahmen der Wahrheit abgeben. Erst die Einbeziehung aller bekannten und noch zu entwickelnder Parameter, die beim juristischen Schließen eine Rolle spielen, kann zu der Einsicht führen, dass es das schließende Erkenntnissubjekt ist, welches einen Sachverhalt aus der Vergangenheit neu konstruiert, dass es dabei höchst aktiv kreiert und dass, sollen Urteile nicht im luftleeren Raum schweben, es dabei schließlich auf Übereinstimmung und Akzeptanz zur sozialen Wirklichkeit mit all ihren grundsätzlich veränderbaren Vormeinungen zu achten hat.
Das wäre wohl der kompliziertere, im Effekt aber doch elegantere, weil widerspruchsfreie Weg, nicht etwas in falsch verstandener Bescheidenheit „für wahr zu halten, weil die volle Wahrheit doch nicht erkennbar ist“, sondern vielmehr auszuloten, was wir unter Wahrheit ohnehin verstehen und sinnvollerweise nur verstehen können.
(1) Der 7. Familienrichtertag am 5. und 7. Mai 1994 in Salzburg, zu welchem der Auto als Referent eines Arbeitskreises geladen wurde, stand unter dem Generalthema der richterlichen Wahrheitsfindung und ihrer Grenzen. Zusammenfassung aus: Wallner, Feststellung und Interpretation. Ein Betrag zum Begriff des Beweisens im Rechtsprozess; iur.Diss., Wien 1993
(2) Karl Engisch, Logische Studien zur Gesetzesanwendung, Heidelberg 1960
(3) Engisch 1960, 113
(4) Engisch, ebenda
(5) Nach Robert Alexy, Theorie der juristischen Argumentation, Frankfurt/main 1991, 281, wurde die gleich zu besprechende Wendung vom „Hin und Herwandern des Blicks“ eher beiläufig in die Methodendiskussion eingeführt.
(6) Engisch 1960, 15
(7) SSt 39/41
(8) SSt 45/23
(9) SSt 45/23
(10) Deutsche BGHZ 53/245, 255 f
(11) Siegried J. Schmidt, Über die Rolle von Selbstorganisation beim Sprachverstehen, in: Wolfgang Krohn, Günter Küppers (Hg): Ermergenz. Die Entstehung von Ordnung, Organisation und Bedeutung, Frankfurt/Main 1992
(12) nach Schmidt 1992, 294ff
(13) nach H. Hörmann, Der Vorgang des Verstehns, in: W. Kühlwein, K. Raasch (g), Sprache und Verstehen, Band 1, Tübingen 1980
(14) Robert Fucik, Das Beweismaß im Zivilprozess, RZ 1988, 122 ff, der aber eine Erklärung schuldig bleibt, wann wir mit diesem Quantensprung zu rechnen hätten.
(15) Schmidt 1992, 296, der sich auf Ballsteadt 1990 beruft
(16) Früh 1980, zitiert bei Schmidt 1992, 296
(17) aaO
(18) Schmidt 1992, 305
(19) vgl. Niklas Luhmann, Die Unwahrscheinlichkeit der Kommunikation, in: soziologische Aufklärung, Band 3, Opladen 1981, 26
(20) nach Schmidt 1992, 304
(21) Schmidt 1992, 305
(22) Dirk Baecker, Die Unterscheidung zwischen Kommunikation und Bewusststein, in Krohn, Küppers (Hg) 1992, 235
(23) Unter anderem deswegen kann es für unseren Bereich immer nur juristische Tatsachen geben: Das Feld der spezifisch rechtlichen Bedeutung von Lebenssachverhalten bezeichnet den Rahmen, innerhalb dessen Phänomenen auf bestimmte Art und Weise Bedeutung zugewiesen wird.
(24) Krohn/Küppers, 1992, Glossar
(25) Ilya Prigogine/Isabella Stengers, Dialog mit der Natur, dt. München 1990, 304
(26) Nach Stephen Hawking, Eine kurze Geschite der Zeit Reinbek 1988, 29
(27) Prigogine/stengers 1990, 47
(28) Hans-Georg Gadamer, Gesammelte Werke, Band 1, Hermeneutik: Wahrheit und Methode – 1, Tübingen 1986, 455 f
(29) Engisch 1960, 4
Quelle: JURIDIKUM 2/95 / Seite 44 / von Dr. Benedikt WALLNER
Asylrechtsdebatte: Christian Romanoski antwortet Benedikt Wallner
In Bezug auf die Sinnlosigkeit der Kritik an „geltender“ Judikatur hätte der Autor des gestern an dieser Stelle publizierten Kommentars („Lernen Sie Jus, Herr Abteilungsleiter!“) dann Recht, wenn es diese Judikatur als solche noch gäbe. Er scheint allerdings völlig übersehen zu haben, dass die von ihm zitierten Entscheidungen des OGH mittlerweile den Bundesgesetzgeber dazu veranlasst haben, den Gerichtshof mittels authentischer Interpretation (ein Mittel, zu dem höchst selten gegriffen wird – in der Sache handelt es sich um ein Gesetz mit rückwirkender Kraft) zu korrigieren.
In der Begründung des Ausschusses für innere Angelegenheiten des Nationalrates heißt es da mit großer Deutlichkeit: „Diese in den genannten Entscheidungen geäußerte Rechtsansicht des OGH sowie die durch sie zu besorgenden Folgewirkungen erscheinen dem Bundesgesetzgeber in mehrfacher Hinsicht nicht unproblematisch: Zum einen laufen sie in entscheidenden Punkten jenen Intentionen zuwider, die vom Gesetzgeber des Bundesbetreuungsgesetzes BGBl. 405/1991 mit der Erlassung dieses Gesetzes verfolgt wurden und denen durch Ausschluss eines Rechtsanspruches auf Bundesbetreuung in § 1 Abs. 3 leg. cit. Ausdruck verschafft werden sollte.“ Durch die rückwirkende Neuordnung der Bundesbetreuung hat der Bundesgesetzgeber seine Rechtssetzungsprärogative wahrgenommen, die letztlich Ausfluss des demokratischen Prinzips unserer Bundesverfassung ist. Damit ist auch die zitierte Judikatur überholt.
Wenn der Autor des Artikels das nicht erkennen will und ein ordentliches Gericht gegen den Gesetzgeber ausspielt, wie im Artikel geschehen, so muss er sich die Frage nach seinem Demokratieverständnis gefallen lassen. Bislang geht das Recht jedenfalls noch vom Volk aus und besteht die Rechtfertigung richterlicher Unabhängigkeit in der völligen Unterordnung der justiziellen Gewalt unter die Legislative. Wie es Montesquieu klassisch ausgedrückt hat: „La bouche qui prononce les paroles de la loi“. Wenn Treue zum Willen des Gesetzgebers „juristischer Unverstand“ ist, so kann und muss jeder Staatsdiener auf diesen „Unverstand“ stolz sein.
Es ist ja nicht anzunehmen, dass ein auch mit Asyl befasster Rechtsanwalt die erwähnten Entwicklungen einfach nicht verfolgt hätte und seine ganze Argumentation nur auf Unkenntnis dieser neuesten Entwicklungen beruht. Ein Blick ins Parlament fördert die Rechtskenntnis.
Quelle: derStandard.at / 21.11.2003 / von Christian Romanoski
Im Asylwesen regiert der juristische Unverstand
Zähneknirschend hat man sich mittlerweile daran gewöhnt, in welch erstaunlichem Maße Wolfgang Schüssels Plan einer „Regierung der besten Köpfe" danebengegangen ist. Doch konnte man als gelernter Österreicher lange Zeit auf die Beharrungskraft des Beamtentums hoffen, das eine sachgerechte Verwaltung schon gewährleisten werde. Nichts da. Auch in der hohen Beamtenschaft hat die Qualität der Regierung mittlerweile deutliche Spuren hinterlassen – und oft drängt sich der Schluss auf, auch hier agierten ziemlich wenige „beste Köpfe".
Der Abteilungsleiter der Asylabteilung im Innenministerium, Christian Romanoski, sieht sein Ressort immer noch im Recht (STANDARD, 13.11.2003), obwohl es der Entscheidung des Obersten Gerichtshofes, obdachlosen Asylwerbern sei verpflichtend Unterkunft und Versorgung durch den Staat zu gewähren, hartnäckig nicht nachkommt; was bereits eine Welle von – letztlich wohl mehreren tausend – Anträgen auf einstweilige Verfügung provoziert, die derzeit anrollt.
Romanoski geniert das offenbar nicht; er versteigt sich gar zu der Formulierung, der Oberste Gerichtshof habe die Unterbringungspflicht des Bundes „entgegen dem Gesetzeswortlaut" festgestellt – und verlässt mit dieser Rechtfertigung die Regeln des juristischen Diskurses: Man kann gewiss auch eine Meinung dazu haben, was und wie der Oberste Gerichtshof judiziert. Die Rechtswissenschaft ist voll von durchaus kontroversiellen Meinungen darüber. Nur eines kann man nicht tun: die Geltung des Spruchs einer OGH-Entscheidung anzweifeln.
Dummheit oder Bosheit?
Man kann also nicht sagen, der OGH hat sich geirrt oder etwas Falsches entschieden, und deswegen richte ich mich nicht nach seiner Anordnung. Oder genauer: Wenn man es tut, ist das halt höchst unklug. Denn es treten daraufhin Mechanismen des Exekutionsrechtes in Kraft, die, so sind sie eben konstruiert, immer zur Niederlage des eigenen Standpunkts führen müssen – und in Fällen wie diesem flutartige Ausmaße annehmen können. Jeder Jurist, der über das 1. Semester hinausgekommen ist, weiß das.
Doch wie das Recht irgendwann begonnen hat, zwischen Wahnsinn und Blödsinn zu unterscheiden, so empfiehlt sich auch in der Politik stets die Unterscheidung zwischen Dummheit und Bosheit. Romanoski ist kein Unbekannter. Früher schrieb er in jener Abteilung, der er heute vorsteht, selbst Bescheide in Asylverfahren; legendäre Bescheide, die Anwälte und Flüchtlingshelfer bis heute im Blindtest erkennen. „Bei ihm mussten wir manchmal Passagen rausstreichen, weil sie so unerträglich waren", zitierte die Stadtzeitschrift Falter kurz nach Romanoskis Bestellung einen Ministeriumskollegen.
Und dabei war das nicht Herausgestrichene immer noch unerträglich genug: Einen ablehnenden Asylbescheid für einen meiner Klienten (der später beim Verfassungsgerichtshof Recht bekam) begründete Christian Romanoski einmal mit der Wendung: „So ist Sicherheit im Augenblick des Betretens dieses Staates als gegeben anzunehmen und vermag einmal erlangte Verfolgungssicherheit durch Verstreichen von Zeit nicht zu wachsen, zumal diesem Begriff nichts Graduelles inhäriert, das heißt nur die Disjunktion sicher/unsicher in Rede stehen kann."
Dabei wusste er wohl, dass mein Mandant nicht deutscher Zunge war, sprich: Romanoski wollte nicht verstanden werden.
Heute, im Widerschein seiner lichtvollen Schelte für den Obersten Gerichtshof, hege ich sogar die Vermutung: Romanoski hat einfach nicht die Aufgabe, dem geltenden Recht zum Durchbruch zu verhelfen. Er ist die Axt des Innenministers im Walde der Gesetze, denen er hochmütig, aber keineswegs ignorant gegenübersteht.
Diese Unterscheidung nach Vorsatz oder bloßer Fahrlässigkeit kann eine Rolle spielen, sobald später einmal danach gefragt wird, ob die Allgemeinheit den immensen Vermögensschaden, den sie durch schlechte Amtsausübung erleidet, von den handelnden Akteuren ersetzt erhält.
Quelle: STANDARD / 20.11.2003 / Seite 31 / von Dr. Benedikt Wallner
siehe auch Kommentar
Auch für das „Abstellen“ Ihres Leihwagens in der verordneten Kurzparkzone Ihres Wohnbezirks werden Sie mit bis zu 210 bestraft, wenn kein Parkschein entwertet wurde. In der Praxis wird das Organ, das die Verwaltungsübertretung feststellt, selbst eine so genannte Organstrafverfügung ausstellen und am Fahrzeug hinterlassen; das kostet 21 . Wenn dem Organ auffällt, dass Sie am nächsten Tag schon wieder dort stehen, dann werden Sie sogar eine Anzeige bekommen. Immerhin besitzt das von Ihnen verwendete Fahrzeug kein gültiges Parkpickerl.
Das Wiener Parkometergesetz sieht keine Ausnahmen für solche Fälle einer erforderlichen Reparatur und der vorübergehenden Leihwagennahme vor.
Aber der Magistrat der Stadt Wien, Abteilung Parkraumüberwachung (MA 67), macht in ständiger Übung eine bürgerfreundliche Ausnahme: Sammeln Sie die während der Reparaturdauer erhaltenen Parkstrafen (gilt natürlich nur für die in Ihrem Wohnbezirk") und schicken Sie sie umgehend an die Stelle, die sie ausgestellt hat, die MA 67. Erläutern Sie schriftlich, dass es sich um ein Leihfahrzeug gehandelt hat und dass sich Ihr eigenes Fahrzeug, das über ein gültiges Parkpickerl verfügt (Kennzeichen angeben"), derzeit in Reparatur befindet. Legen Sie den Leihvertrag in Kopie oder eine Bestätigung der Werkstatt bei, damit die Behörde beurteilen kann, dass es sich wirklich so verhält, wie Sie behaupten.
Falls bereits eine Anzeige erfolgt ist, so werden Sie erst später davon erfahren, wenn Ihnen nach einigen Wochen eine Strafverfügung oder Anonymverfügung zugestellt wird. Hier müssen Sie wieder genauso vorgehen, ein einmaliges Ersuchen reicht leider nicht. Die Behörde wird sich großzügig zeigen und Ihre Strafe annullieren.
Dr. Benedikt Wallner, Rechtsanwalt
Quelle: KURIER | 05.07.2002 | Seite 7
Quelle: polylog / Nr. 14/2006 / Seite 67 bis 89 / von Benedikt Wallner